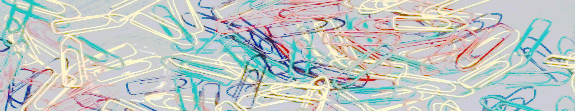Ursachen für die Straflosstellung und Wiedereingliederung der Schreibtischtäter
Ich werde immer wieder danach gefragt, warum die an den nationalsozialistischen Verbrechen beteiligten Richter und andere Juristen kaum zur Rechenschaft gezogen worden sind. Und warum man sie anstandslos wieder in den Reihen der Justiz aufgenommen hat.
Meine Vermutung: Es fehlte (und fehlt übrigens sogar noch heute) weithin an einem Vorstellungsvermögen für das Wesen und die Arbeitsweise eines Schreibtischtäters.
Bei den meisten dieser Täter handelte (und handelt) es sich um mehr oder weniger gebildete Menschen mit achtbarer Lebensgeschichte, unter Verkörperung der sogenannten bürgerlichen Sekundärtugenden:
Pflichtbewusstsein, Korrektheit, Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit, mit einer – im Verkehr mit Angehörigen der gleichen Schicht – großen Hilfsbereitschaft, angenehmen Umgangsformen, mit meist überdurchschnittlich guten Fachkenntnissen und Erfahrung ausgezeichnet. Überwiegend handelt es sich um Juristen und nahestehende Akademiker.
Persönlichkeiten von derart bürgerlicher Reputation und offensichtlicher Rechtschaffenheit, darunter Gerichtspräsidenten, Ministerialräte und überwiegend Akademiker mit Doktortiteln, passen nicht in die übliche bürgerliche Vorstellung von einem Schwerkriminellen. Das verbreitete idealisierte Bild insbesondere eines Juristen passt nicht zu dem vorherrschenden Bild eines „Verbrechers“.
Und dann meine persönlichen Erfahrungen. Mir sind diese Menschen ähnlich begegnet, sowohl dienstlich als auch im persönlichen, privaten Umgang. Viele zeigten gegenüber dem Referendar und angehenden Richter, später gegenüber dem jungen Assessor ein ausgesprochenes Wohlwollen. Allerdings hatte ich bei den meisten noch keine Kenntnis von deren Verbrechen. Allenfalls gab es Gerüchte. Jedenfalls unterschieden sie sich nicht von den völlig unbelasteten Kollegen.
Besonders deutlich ist mir das in der Erinnerung an meinen Doktorvater Ernst Rudolf Huber geworden. Natürlich gab es unter den Professoren (damals in Freiburg) im menschlichen Umgang Unterschiede. Einige waren im Umgang mit Studenten kurz angebunden oder sonst unangenehm. Ernst Rudolf Huber hob sich davon äußerst positiv ab. Ich konnte mich mit ihm über mein ohnehin geistes- und politikgeschichtlich weitgespanntes Thema meiner Doktorarbeit, die deutsche Verfassungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts unterhalten, einschließlich der Weimarer Republik (die Jahre 1933 bis 1945 blieben allerdings ausgespart, aus einer Scheu auf beiden Seiten. Bei unserem letzten längeren Abend, in einem Göttinger Restaurant (1967), habe ich allerdings das in der Weimarer Republik zu beobachtende „zweierlei Maß“ der Justiz angesprochen. Da gab es eindeutige Abwehr auf seiner Seite). In jenen Jahren (den fünfziger Jahren) sind mir aber wenige Menschen begegnet, mit denen man sich so gepflegt und geistreich unterhalten konnte. Hinzu kam die Abstraktheit seiner „Verbrechen“. Er hatte ja „nur“ zu Verfassungs- und anderen Rechtsfragen Stellung genommen. Auf den ersten und wohl auch zweiten Blick schien es keine Opfer zu geben. Dies, obgleich etwa das Gutheißen etwa der Entrechtung der Juden, überhaupt die Legitimation des nationalsozialistischen Rechtssystems in der Summe einen viel größeren Beitrag zum Unrechtssystem lieferte, als etwa ein gegen Juden gerichtetes einzelnes Räumungsurteil eines Amtsgerichts. Eine erste Lehre daraus: bleiben die Opfer unsichtbar, verschwimmen sie im Nebel der Wahrnehmung, vermag man auch nicht ohne weiteres einen Täter erkennen.
Kann man eine solche Rechtsblindheit auch solchen Juristen zubilligen, die ein Todesurteil oder gar mehrere Todesurteile verhängt haben? Auch da kommt es möglicherweise auf das Vorstellungsvermögen an. Könnte es sein, dass im abstrakten Denken geübte Juristen auch hier das letzte Vorstellungsvermögen fehlt? In bitteren Unterhaltungen mit meinen Freunden über die Straflosstellung der Mörder in der Robe lautete eine zynische Feststellung: „Man stirbt nicht an einem Todesurteil“. Theoretisch stimmt das sogar. Denn jedes Todesurteil musste von höchster Stelle, nämlich vom Reichsjustizministerium, bestätigt werden. Spätestens ab 1941 gab es aber in 99 oder mehr Fällen von 100 Todesurteilen keinen Gnadenerlass. Und in meinem großen Aufsatz über ein Verfahren des Sondergerichts Leslau habe ich geschildert, dass Staatssekretär Roland Freisler sich für eine Begnadigung einsetzte, was der Oberstaatsanwalt Bengsch in Leslau aber energisch hintertrieb. Jedenfalls diente die Befürwortung von Gnadenerweisen durch Richter der Sondergerichte der Entlastung des Gewissens (Stichwort: Pilatusgebärde).
Die Einsicht, dass gediegenes Juristentum zusammenfallen kann mit der Beteiligung an bislang für unvorstellbar gehaltene Massenverbrechen würde das vorherrschende richterliche Selbstverständnis in Frage stellen. Aus vielen Begründungen, mit denen in der Nachkriegszeit Verfahren gegen Juristen eingestellt worden sind, scheint man eine nahezu unwiderlegliche Vermutung herauszuhören, dass Juristen Untaten wie Rechtsbeugung oder Totschlag und Mord nicht zuzutrauen sein. Ja, Rechtsbeugung wird zu einer psychologischen Unmöglichkeit erklärt. Es sei doch völlig logisch: „Kein Richter wird so töricht sein, seine eigene Existenz aufs Spiel zu setzen, indem er bewusst zum Vor- oder Nachteil eines ihm letztlich unbekannten Menschen Recht beugt; es ist also kaum anzunehmen, dass hier Rechtsbeugung vorliegt“ (aus der Einstellungsbegründung der Staatsanwaltschaft Bückeburg vom 23.2.1980 in dem Verfahren gegen Alfons Bengsch). Die Eigenschaft als Richter oder Staatsanwalt wird gewissermaßen zum Gütesiegel, das nahezu absoluten Schutz vor Bestrafung wegen Rechtsbeugung bietet. Die Robe wird zum Schutzschild.
Nochmals zum Vorstellungsvermögen für das Wesen eines Schreibtischtäters:
Vielleicht rührt die Abneigung davor, uns auf eine nähere Auseinandersetzung mit diesem Persönlichkeitstyp einzulassen, auch aus der Sorge, eigene Verhaltensweisen darin wiederzuerkennen, mit der bangen Frage: Wozu bist Du selbst fähig? Dieses Unbehagen hat der polnische Aphoristiker Jercy Stanislaw Lec mit dem Satz gekennzeichnet:
„Das Gesicht meines Feindes entsetzt mich, weil ich sehe, wie sehr es dem meinigen ähnelt“.
Dieses irritierende Phänomen kam anschaulich zum Ausdruck, als persönlich besonders integere Persönlichkeiten sich für die Freilassung des Dr. Martin Sandberger einsetzten. Martin Sandberger hatte sich als Führer des Einsatzkommandos I a für die Ermordung von mindestens 5.000 Menschen zu verantworten. In den Jahren 1941/42 hatte er Estland „judenfrei“ gemacht. Im Nürnberger Einsatzgruppenprozess war er im April 1948 zum Tode verurteilt worden. Später wurde die Exekution ausgesetzt, und 1959 wurde Sandberger endgültig entlassen. U. a. hatten sich der Vizepräsident des Bundestages Carlo Schmid für Sandberger eingesetzt: Es handele sich bei diesem gewiss nicht um einen „blindwütigen Fanatiker“; vielmehr sei er ein „fleißiger, intelligenter und begabter Jurist“ gewesen, der ohne den Nationalsozialismus gewiss ein „ordentlicher, tüchtiger, strebsamer Beamter“ geworden wäre und nur durch übergroßen Ehrgeiz zum Sicherheitsdienst gekommen sei. „Man sollte Martin Sandberger eine Chance geben, sich im Leben neu zu bewähren. Ich bin davon überzeugt, dass Landsberg ihn geläutert hat“. Auch Bundespräsident Theodor Heuss setzte sich für Sandberger ein (vgl. Norbert Frei, Vergangenheitspolitik, S. 297 ff.).
Auf ähnliche Weise erklären sich die vielen „Persilscheine“, die NS-Verbrechern in den Entnazifizierungsverfahren zur Entlastung verhalfen. Letztlich ausschlaggebend für die Persilscheine war der persönliche Eindruck, den sie von dem Betroffenen hatten, die Untaten selbst spielten nur eine sekundäre oder sogar überhaupt keine Rolle. Merkwürdig ist das allerdings, wenn man fragt, ob ein ungelernter, ungebildeter SS-Mann, der niemals Zugang zu den „besseren Schichten“ gehabt hatte, irgendwelche Chancen auf Erlangung eines Persilscheins gehabt hätte. Selbst wenn unbelastete Arbeitskollegen ihm eine solche Bescheinigung ausgestellt hätten, hätte das im Ergebnis keine Wirkung gehabt. Sie waren ja keine Personen von Bedeutung.
Sehr beeindruckt hat mich ein Persilschein zu Gunsten des ehemaligen Berliner Generalstaatsanwalts Dr. Friedrich Jung (u. a. beteiligt an der Folterkonferenz im Reichsjustizministerium vom 5. Juni 1935 und an der großen Konferenz der Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte am 23./24. April 1941 in Berlin, mit der die Justiz ihr Plazet zur Ermordung von über 70.000 Geisteskranken gegeben hatte). Ausgestellt war der Persilschein von dem Pfarrer Albrecht Goes (zu Albrecht Goes vgl. Peter Derleder, in Kritische Justiz 2010, S. 353 ff.).