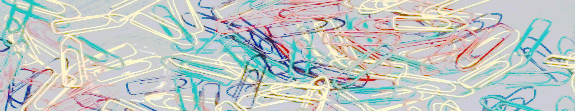Harald Franski
Harald Franzki (1925-2005)
Am 25. Juli 2005 verstarb im Alter von 80 Jahren der frühere Präsident des Oberlandesgerichts Celle Dr. Harald Franzki. Er war – so heißt es in dem Nachruf der Pressestelle des OLG Celle – „eine große Richterpersönlichkeit, die weit über die Grenzen des Celler Bezirks hinaus auf Grund herausragender fachlicher Qualitäten höchstes Ansehen genoss. Ihn zeichneten Gerechtigkeitssinn und Zivilcourage, aber auch menschliches und soziales Verständnis aus.“ Einem solchen Lob wird niemand widersprechen wollen. Franzki wird von denen, die ihn kannten, als eindrucksvolle Persönlichkeit geschildert, als Mann mit für sich einnehmendem Auftreten, angenehm im Umgang mit seinen Mitarbeitern, allerdings sehr beherrschend, mitunter autoritär.
Zu einer Richtigstellung fordert allerdings heraus, was in dem Nachruf über die Verdienste Franzkis um die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Justiz zu lesen ist: Er „erkannte schon früh die Notwendigkeit der Aufarbeitung auch der jüngeren Justizgeschichte. Ihm ist es maßgeblich zu verdanken, dass sich das Oberlandesgericht Celle im Rahmen seines 275jährigen Jubiläums auch der Aufarbeitung des dunkelsten Kapitels seiner Geschichte, den Jahren von 1933 bis 1945, widmete.“ Im Unterschied etwa zu der Geschichte des OLG Celle, einem in Vorträgen des Celler Vizepräsidenten gern behandeltes Thema, herrschte über die nationalsozialistische Justiz am OLG Celle in geschlossener Abwehrfront noch allseitiges Schweigen, als wenige Außenseiter innerhalb und außerhalb der Richterschaft auf eine Aufarbeitung drängten und Taten und Namen nannten. Als allerdings das zunächst noch immer unwillige Niedersächsische Justizministerium sich der von den gewerkschaftlich organisierten Richtern und Richterinnen mit Unterstützung der Presse erhobenen Forderung nach einer Tagung der Deutschen Richterakademie zur NS-Justiz nicht länger entziehen konnte (1983), sprang Harald Franzki, ähnlich wie sein Braunschweiger Kollege Rudolf Wassermann auf den anfahrenden Zug auf. Nun hielt er sich sogar an erster Stelle berufen und ließ sich, ohne durch eine Veröffentlichung oder auf andere Weise ausgewiesen zu sein, als Referent auf das Programm der ersten Tagung der Deutschen Richterakademie zur NS-Justiz setzen. Was er vorzutragen hatte, schlug Wellen bis in die Spalten der überregionalen Presse und in die Niedersächsischen Landtagsverhandlungen. Über die Untaten der NS-Strafjustiz erfuhr man zwar wenig. Stattdessen räsonierte der Präsident darüber, dass in Auschwitz gar nicht so viele Juden umgekommen seien, wie der KZ-Kommandant Höss in seiner Prahlsucht behauptet habe. Auch habe man die Insassen des Lagers Bergen-Belsen und die sowjetischen Kriegsgefangenen nicht absichtlich verhungern lassen. Es habe vielmehr an Versorgungsschwierigkeiten gelegen. Im übrigen müsse man bei der Frage nach der Schuld des deutschen Volkes die Empörung über den Versailler Friedensvertrag berücksichtigen. Bedauerlicherweise sei Rudolf Heß nun schon mehr als die Hälfte seines Lebens in Haft. Die Frage nach dem Umgang mit der NS-Justiz nach 1945, insbesondere die strafrechtliche und personelle Aufarbeitung, wurde aus der Tagung fast ganz ausgeklammert. Franzki, der sich zugleich zum Tagungsleiter ernannt hatte, suchte auch sonst kritische Stimmen aus der Tagung fernzuhalten: durch eine gezielte Teilnehmerauswahl, und Bevorzugung hochrangiger Richter und Staatsanwälte, und durch die Ankündigung, gegenüber unangemeldeten Personen gegebenenfalls das Hausrecht auszuüben.
Und die in dem Nachruf der so gelobten Festschrift zum 275jährigen Bestehen des OLG Celle? Neben der Entlassung der jüdischen Richter nach 1933 und einer Abhandlung zum Erbgesundheitsgericht Celle erfährt man so gut wie nichts zu der Urteilstätigkeit des OLG, dafür um so mehr über die von der NSDAP ausgehende „Politisierung“ und dass „Vernunft, Standhaftigkeit und Rechtsbewusstsein hier noch manches abwenden und dämpfen“ konnten. Die Entnazifizierungsphase nach 1945 wird im wesentlichen nur abstrakt und ohne Namensnennung behandelt, mit dem Fazit, die Vergangenheit der nach 1945 wieder eingestellten Richter sei „nicht nur oberflächlich untersucht“ worden, sondern in einer „besonders gründlichen Überprüfung“. Die wenigen Personenbeispiele beschränkten sich auf das Bedauern, dass die betroffenen Richter zunächst überhaupt um ihre Wiedereinstellung hatten kämpfen müssen. Darüber, an welchen Justizverbrechen die wiedereingestellten und oft weiterbeförderten Richter beteiligt waren, wird nichts mitgeteilt, mit einer einzigen Ausnahme, der eines Senatspräsidenten (Otto Wöhrmann) – dessen Name aber gleichfalls verschwiegen wird. Dabei standen Datenschutzgründe der Nennung von an Todesurteilen beteiligten Richter nicht entgegen. Und viele der in der Festschrift verschwiegenen Namen waren andernorts längst genannt worden, beispielsweise in dem schon 1981 zur Celler NS-Geschichte erschienenen Buch „Hinter den Fassaden“, Fassaden in die die Justiz auch weiterhin keinen unverstellten Blick werfen mochte. So war die Aufnahme des Abschnitts 1933-1945 in die Festschrift eine Alibi-Aktion, mit der man der seit etwa 1980 auf eine Aufarbeitung der NS-Justiz drängenden öffentlichen Meinung den stärksten Wind aus den Segeln nehmen wollte.
Wenn beim Thema Verdrängung und Verharmlosung der NS-Justiz nach 1945 auch der Name Franzki genannt werden muss, sollte man allerdings den Aspekt der persönlichen Tragik nicht übersehen. In seinem Vorwort zu der Festschrift schrieb Franzki, „man dürfe vor dieser Zeit nicht die Augen verschließen, nur um unsere eigenen Gefühle (...) zu schonen.“ Diese Mahnung hat Franzki selbst nicht beherzigt. Wenn im Widerstreit zwischen dem Bestreben zu einer ungeschönten Darstellung der Geschehnisse von 1933-1945 und der Sohnesliebe sein Blick zu Gunsten der Verharmlosung getrübt war, darf man freilich eine schwere Bürde nicht vergessen: Franzkis Vater war Reichsanwalt, der an zahlreichen Todesurteilen des Volksgerichtshofs beteiligt war. Erst die in jüngster Zeit zunehmend erschienenen Biographien der Söhne oder (meist Töchter) von Tätern der NS-Zeit haben darauf aufmerksam gemacht, wie unterschiedlich eine solche familiäre Vorgeschichte verarbeitet werden kann, mitunter abgleiten in das eine oder andere Extrem. Diejenigen, die - im Vergleich zu den oft starren Laufbahnen der meisten Juristen - schon in Ausbildung und Berufswelt mehr in selbstkritischer Reflexion geübt sind (z.B. Psychologen, Schriftsteller, Journalisten), lassen bei aller bleibenden familiären Verbindung keinen Zweifel an ihrer Erschütterung über die Taten ihrer Väter. Bei einigen ist die Vorwurfshaltung sogar in Wut umgeschlagen, wie bei Niklas Frank, dem Sohn von Hans Frank. Vor allem den Juristensöhnen ist eine freimütige Auseinandersetzung mit dem Vater nicht gelungen. Einige haben oftmals große Energie daran aufgewandt, um mit der gesamten Vätergeneration auch Kritik vom eigenen Vater abzuwenden. Ein Beispiel ist der ehemalige Botschafter Dr. Ernst Jung. Als Sohn des furchtbaren Berliner Generalstaatsanwalts, eines schwerbelasteten NS-Täters, hat er sogar viele Jahre vor Gericht verbissen um die Ehre seines Vaters gekämpft (vgl. dazu Heinrich Hannover, Die Republik vor Gericht 1975-1995, S. 307 ff). Celler Juristen hatten ihm immer wieder den Rücken gestärkt.