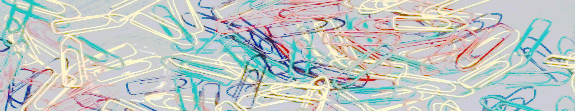Wie man Opfern ihren Namen zurückgibt
Wie man Opfern ihren Namen zurückgibt
Helmut Kramer in der Zweiwochenschrift für Politik / Kultur / Wirtschaft <Osietzky> Heft 09/2012:
Jahrzehnte lag in der Bundesrepublik Deutschland über den faschistischen Untaten der Mantel des Verschweigens und des Verdrängens. Offizielles Gedenken beschränkte sich auf die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Allmählich rückten dann auch andere Opfer in den Blick des öffentlichen Interesses, aber einige wichtige Opfergruppen blieben nach wie vor lange Zeit ausgeblendet. Das Gedenken ging über vage Äußerungen von Betroffenheit kaum hinaus. Jede Konkretisierung hätte ja zwangsläufig an die Täter und die zugrundeliegenden Mentalitäten und Strukturen erinnert. Das gilt noch immer für viele Gedenkstätten, die es möglichst vermeiden, über die Täter zu informieren. Selbst in der Wolfenbütteler Gedenkstätte zur NS-Justiz erfährt man nur wenig über die juristischen Schreibtischtäter (s. Ossietzky 8/12). Der Forderung, die Verantwortung der Täter stärker zu beachten, sind der Gedenkstättenleiter Wilfried Knauer und sein Vorgesetzter Habbo Knoch, Geschäftsführer der in Celle ansässigen Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, mit der Begründung ausgewichen, »Primäraufgabe« sei das Gedenken an die Opfer. »Der Respekt vor den Opfern gebietet es, an dieser Primäraufgabe keine Abstriche zu machen.«
Wie Knoch und Knauer es mit dem Gedenken an die Opfer halten, zeigt sich an ihrer einzigen in Wolfenbüttel entfalteten Aktivität. Als Teil der fast alle Kräfte in Anspruch nehmenden Aufgabe der »Schicksalsklärung«, deren Umfang aber weder in Form von Opferbiographien noch durch irgendeine Veröffentlichung belegt ist, hat man sich viele Jahre lang der Gräberarbeit gewidmet. Dabei ging es um die Rekonstruktion der unter einem Rasenfeld (Gräberfeld 13 a) verborgenen Reihengräber von zur Zwangsarbeit gezwungenen sowjetischen Kriegsgefangenen und anderen osteuropäischen Zwangsarbeitern. Diese Aufgabe konnte anhand eines exakten Lageplans der Wolfenbütteler Friedhofsverwaltung aus den Jahren 1940–45 gut bewältigt werden. Dafür vor allem die Hilfe von Schülern in Anspruch zu nehmen war sinnvoll. Schülern wird ja sonst wenig Gelegenheit zu aktivem Engagement geboten. Beraten wurden die Schüler unter anderem von mehreren Lehrern und dem Wolfenbütteler Gedenkstättenleiter Knauer. Wiederholt präsentierte er sich und sein Projekt in der Wolfenbütteler Lokalzeitung unter der Überschrift: »Opfern ihre Namen zurückgeben«. Unter diesem anspruchsvollen Titel posierte er auch auf einem Großfoto der Zeitung.
Wie der Gedenkstättenleiter den Anspruch der Namensrückgabe verwirklicht hat, erweist sich am Beispiel des im vorigen Ossietzky-Heft schon erwähnten in Wolfenbüttel hingerichteten und begrabenen Justizopfers Moritz Klein. Doch der Name kommt in der Gedenkstätte nicht vor.
Auf dem Friedhof haben inzwischen ebenso wie die unter dem Rasen liegenden Zwangsarbeiter auch die bestatteten Justizopfer Namensplaketten erhalten. Doch nicht an Moritz Klein wird hier erinnert, sondern an »Moses«. Moses Klein war der ihm durch eine Verordnung zum Personenstandsgesetz von 1938 auferlegte Zwangsname, den er nun an erster Stelle als »typisch jüdisch« führen mußte. In der opulenten, in Farbdruck aufgemachten, unter der Verantwortung des Gedenkstättenleiters und des Stiftungsgeschäftsführers Knoch herausgegebenen Dokumentation »Gräberfeld 13 a« erscheint er sogar als »Moses Israel« Klein. »Israel« war der verbale Judenstern. Männer erhielten diesen Namenszusatz, Frauen den Zweitnamen Sara.
Nicht einmal bei der Kennzeichnung und Pflege der Gräber nahm man die »Primäraufgabe« des Opfergedenkens wirklich ernst. Im Unterschied zu den dauerhaften Metallschildern für die Zwangsarbeiter sind die Grabplaketten für die Justizopfer aus billigem Plastik. Auf die kleinen Grabsteine lediglich aufgeklebt, haben viele Namensplaketten sich schon nach zwei Jahren vom Stein gelöst. Vom Wind verweht, sind viele verschwunden. Unwürdig ist auch der Gesamtzustand. Alle Namensschilder sind bis zur Unkenntlichkeit verschmutzt, mit Laub, Erde, Unrat bedeckt. Seit einem Fototermin mit der Presse vor zwei Jahren haben der Gedenkstättenleiter und der Stiftungsgeschäftsführer sich nicht mehr um die Gräber gekümmert.
Das aufwendige Projekt, zu dem unter Beteiligung belorussischer Schüler mehrere »Workshops« und Zeitzeugengespräche in Belorußland gehörten, stand unter dem Motto »Lernen aus der Geschichte«. Hier müßte vor allem über das Zwangsarbeitersystem und seine Hintergründe informiert werden. In der geweckten Erwartung, man habe die Ruhestätte von mehr als 400 Menschen zum bleibenden Lernort für alle Bürger gemacht, sieht man sich aber enttäuscht.
Kein einziges Hinweisschild führt zu dem Gräberfeld, nicht einmal am Eingang des Friedhofes. Weil die unauffälligen Grabplaketten höhengleich mit der Rasenfläche verlegt wurden, eilen fast alle Friedhofsbesucher achtlos an der Wiese vorbei. Eine im Jahre 2008 errichtete »Geschichts- und Erinnerungstafel«, mit der das Gräberfeld »dauerhaft gekennzeichnet werden« sollte, ist inzwischen wieder entfernt. Mit seinem Presse- und Fototermin im März 2010 hat der Wolfenbütteler Gedenkstättenleiter seine Arbeit auch hier beendet.
Es fehlt an der notwendigsten Information. Wer liegt hier unter der Erde? Selbst wenn man davon gehört hat, daß es sich um Zwangsarbeiter und Justizopfer handelt, bleibt man ohne Antwort auf die wichtigsten Fragen, nämlich nach der ungefähren Herkunft der Opfer und nach den Todesumständen.
Auch die für die allgemeine Bildungsarbeit bestimmte Dokumentation »Das Gräberfeld 13 a« hält wichtigste Informationen zurück. Zu einem großen Teil ist sie mit sich ermüdend wiederholenden Artikeln der Wolfenbütteler Zeitung gefüllt. Über das Wichtigste zum Verständnis des menschenrechtswidrigen Zwangsarbeitersystems erfährt man so gut wie nichts: nichts über die grausamen Umstände, unter denen die Opfer, darunter sogar Kinder, aus ihrer Heimat in Osteuropa, später noch aus Italien und Frankreich, verschleppt wurden, auch kaum etwas über die Bedingungen, unter denen die Verschleppten arbeiten und in primitiven Unterkünften bei schlechten Ernährungsbedingungen leben mußten, nichts darüber, warum in wenigen Jahren so viele von ihnen starben und schon gar nichts über vorenthaltene Entschädigung und unterlassene Strafverfolgung der Verantwortlichen. Leider haben die Gedenkstätte und die Stiftung es auch sonst bislang zu keiner Veröffentlichung gebracht, die über das NS-Zwangsarbeitersystem berichtet, nicht einmal über jene Form von Zwangsarbeit, zu der auch Wolfenbütteler Strafgefangene unter anderem in die Konzentrationslager Mauthausen und Neuengamme geschickt wurden – zur »Vernichtung durch Arbeit« innerhalb weniger Monate oder Wochen.
Mit einer einzigen Ausnahme: einem kargen Text zu dem Schicksal des in Wolfenbüttel hingerichteten polnischen Zwangsarbeiters Stefan Serwien. Warum wird nicht wenigstens auch über den im Alter von 17 Jahren aus Italien verschleppten Francesco Paolin berichtet, der wegen eines auf der Flucht aus der Zwangsarbeit begangenen Notdiebstahls hingerichtet wurde. Paolins erschütternden Abschiedsbrief an seine Mutter sandten gefühllose Braunschweiger Staatsanwälte nicht ab, auch nicht nach Kriegsende. Und warum sagt die Ausstellung nichts über die mit 14 Jahren aus Polen nach Wolfenbüttel zur Zwangsarbeit verschleppte Janina Piotrowska?
Wer sich von der Website der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten Informationen über die Weiterführung des unter ihrer Verantwortung stehenden Gräberfeldprojekts verspricht, wird ebenso enttäuscht. Wie die erwähnte Publikation bleibt die Website bei dem Stand von Anfang 2007 stehen.
Wenn die Gedenkstätte aber aus ihrem Schlaf erwachen und beispielsweise für eine Biographie über Moritz Klein sorgen würde, müßte sie auch Hans Globke erwähnen, den Staatssekretär Konrad Adenauers. Globke hatte die juristischen Vorarbeiten für die diskriminierende Namensgebung 1938 geleistet.